In meiner Jugend gingen wir in ein kleines Milchgeschäft im Nachbarhaus der elterlichen Wohnung einkaufen. Direkt daneben befand sich ein Gemüseladen, der von einem Herrn Crawshaw geführt wurde. Während die Milchfrau ihre Kund*innen in einem breiten Meidlinger Dialekt bediente, tat sich der Gemüsehändler mit der Kommunikation schwer. Im Umgang mit den Kund*innen war er auf einige wenige Brocken meist unverständlicher deutscher Sprache angewiesen, die uns immer wieder zum Lachen brachten. Herr Crawshaw war der Ehemann der Milchfrau. Er hatte sie als britischer Besatzungssoldat geheiratet und – learning by speaking – versucht, das Idiom seiner Frau anzunehmen. Doch recht überrascht waren wir, als in unserer Gasse einmal ein Engländer auftauchte und um eine Auskunft bat. Wir schickten ihn zu Herrn Crawshaw in der Vermutung, die beiden würden sich in ihrer gemeinsamen Muttersprache gut verständigen können. Herr Crawshaw aber verweigerte den Kontakt und schickte den Fremden in ein naheliegendes Hotel: Dort würde ihm der Englisch sprechende Rezeptionist weiter helfen können.
Auf diese Art lernte ich, dass man eine Sprache nicht nur lernen sondern auch verlernen kann. Und ich musste meine bis dahin gehegte falsche Vermutung, „Muttersprache“, einmal erworben, wäre so etwas wie ein integraler, unveräußerlicher Bestandteil jedweder Persönlichkeit, zumindest stark relativieren.
Sprachlosigkeit als Muttersprache
Daran erinnert wurde ich bei der Lektüre des Romans „Vor der Zunahme der Zeichen“ von Senthuran Varatharajah .Konzipiert als ein Facebook-Roman berichtet der Text von einer digitalen Kommunikation zwischen einem Tamilen und einer Kosovarin. Beide hat es auf Grund widriger Lebensumstände in ihrer Heimat nach Deutschland verschlagen. Sie verständigen sich auf Deutsch als einzig mögliche Kommunikationsform und lassen dabei ihre jeweiligen „Muttersprachen“ hinter sich.
In einem ausführlichen und sehr hörenswerten Radio- Gespräch (https://oe1.orf.at/player/20180706/519641) denkt Senthuran Varatharajah anhand seiner Erfahrungen als Deutscher mit tamilischen Wurzeln über die kulturpolitischen Konsequenzen nach, die unweigerlich mit dem Konzept der „Muttersprache“ verbunden sind. Immerhin wird – zumal in kulturkonservativen Kontexten – der Kenntnis der „Muttersprache“ eine elementare Bindungskraft zugesprochen. So entscheidet die Art und Weise des Umgangs mit der „Muttersprache“ über die Qualität einer Zugehörigkeit, die sich sei es über das Blut (jus sanguinis) und damit die Mutter oder über die Nation (jus solis) vermittelt. Die einfach Formel „Red Deitsch“, die gerne von Rechtspopulistischen Kulturbewahrer*innen gegenüber Migrant*innen ins Treffen geführt wird, stellt dabei die einfachste Formel für die Erwartung dar, dass die Kenntnis einer „Muttersprache“ aufs Engste mit dem Anspruch auf Zugehörigkeit zu einer Kultur und damit zu einer Nation, im rechten Jargon zu einem Volk verbunden wird.
Die Konversation von Senthil Vasuthevan und Valmira Surroi in Varatharajas Roman macht deutlich, dass das Konzept der „Muttersprache“ in einer auch sprachlich vielfältigen Migrationsgesellschaft keine reale Entsprechung mehr findet. Varatharan berichtet eindrucksvoll über seinen wechselvollen Umgang mit Sprache(n); etwa wenn er - der bereits im Alter von wenigen Monaten nach Deutschland gekommen ist – beginnt, mit seinen Eltern Deutsch zu sprechen, sie ihm auf Tamilisch antworten und daraus beträchtliche Irritation innerhalb der Familie entsteht. Und er erzählt davon, wie das ist, eine Sprache, die am Anfang des Lebens gestanden ist, zu verlernen und sich stattdessen einer anderen zu bedienen, um sich in einer neuen Umgebung zurecht zu finden und wahrgenommen zu werden.
Sprache erzählt immer weniger über Zugehörigkeit
Als Philosoph von Beruf lässt Varatharajah ausschließlich „Sprachlosigkeit“ als „Muttersprache“ gelten und macht damit deutlich, was den Millionen Migrant*innen zur Zeit im Umgang mit sprachlichen Widrigkeiten wiederfährt. Die meisten lösen sich von ihren muttersprachlichen Kontexten und sehen sich gefordert, die Sprache zu erlernen, in der sie am besten verstanden werden. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass damit emotionale Bindungen etwa an das Land aufgebaut werden, in der diese neue Sprache gesprochen wird; ihrer Nutzung beschränkt sich zuallererst darauf, sich in einer Weise auszudrücken, die von den übrigen Mitgliedern der lokalen Gesellschaft nachvollzogen werden kann. Die emotionale Bindung hingegen – so jedenfalls meine Vermutung – wächst mit der umfassenden Akzeptanz in der neuen Umgebung und weist wesentlich über eine spezifische Sprachfähigkeit hinaus.
Wachsende Mobilität, aus welchen Gründen auch immer bedeutet aber auch, dass die Menschen, die sich gezwungen sehen, von einer Sprache in die andere zu wechseln, „andere“ Geschichten erzählen oder zumindest dieselben Geschichten „anders“. Varatharajah macht das anhand seines Herkunftslandes deutlich: Dieses sei ihm weitgehend fremd geblieben; er habe lange Zeit vermieden, dorthin „zurück“ zu reisen. Stattdessen trieb es ihn in alle möglichen und unmöglichen Teile der Welt, in denen er seine ihm eigene Fremdheit ausleben und ertragen lernen konnte. Ihm sei Herkunft zuallererst Vergessen zumal er – in welcher Sprache auch immer – sich nicht in der Lage sieht, die einzig wahre Geschichte seiner eigenen Vergangenheit zu erzählen.
Statt dessen sieht er sich umstellt von einer Vielfalt an Geschichten, wie es gewesen sein könnte, ohne dass es eine gäbe, auf die er sich noch einmal verbindlich einlassen wollte. Und so ist ihm, als würde er auf immer neue Weise „Geschichten“ anprobieren und prüfen, welche seiner aktuellen Lebenssituation am besten entspricht. Dabei kann er sich einen Hinweis auf die Psychoanalyse Sigmund Freuds nicht verkneifen. Ihr zufolge könne die Frage, ob es so gewesen sei nur damit beantwortet werden könne, dass man sich daran so erinnere. Würde man sich aber erinnern, dann könne man sicher sein, dass es so nicht gewesen ist.
Sprache ist eng an das Wissen um die Sterblichkeit geknüpft – Das macht die Brisanz der Auseinandersetzung aus
Dabei ist die Brisanz der aktuellen Diskussion um Spracherwerb durchaus nachvollziehbar. Immerhin handelt es sich beim Sprachgebrauch um eine sehr elementare menschliche Fähigkeit. Das wusste schon Martin Heidegger, der in seinem Vortrag „Das Wesen der Sprache“ gemeint hatte: „Die Sterblichen sind jene, die den Tod als Tod erfahren können. Das Tier vermag des nicht. Das Tier aber kann auch nicht sprechen. Das Wesensverhältnis zwischen Tod und Sprache blitzt auf, ist aber noch ungedacht“. Und auch die Überlegungen Ludwig Wittgensteins, wonach die Grenzen der Sprache die Grenzen der erfahrbaren Welt darstellen würden, deuten darauf hin, dass Sprache eng an die Möglichkeiten und Widrigkeiten menschliche Existenz gebunden sind.
Die „eigenen“ Leute nicht verstehen können oder Die Fiktion einer einheitlichen deutschen Sprache ist eine politische Konstruktion
Bloß um welche Sprache geht es? Dazu noch eine kleine persönliche Geschichte. Ich habe Verwandte in einem kleinen oberösterreichischen Dorf, die ich als Jungendlicher gerne im Sommer besucht habe. Nahe der bayrischen Grenze gelegen bedienten sich die dort lebenden Menschen eines Dialekts, das ich fast überhaupt nicht verstehen konnte. Es brauchte Tage der Gewöhnung, um zumindest die wichtigsten Botschaften nachzuvollziehen; die sprachlichen Feinheiten der ortsüblichen Konversation blieben mir in der Regel verborgen.
Diese Erfahrung bringt mir in Erinnerung, dass der Forderung „Red Deitsch!“ gar nicht so einfach nachzukommen ist.Immerhin ist es gar nicht so lange her, dass man sich entlang einiger weniger literarischer Pioniere und in der Folge im Rahmen eines politischen Willensaktes dazu entschlossen hat, eine gemeinsame deutsche Literatursprache mit überlandschaftlichen Charakter für verbindlich zu erklären. Es war diese die Folge der großen politischen und konfessionellen Zersplitterung deutscher Gebiete nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs. Das Ergebnis zeigt sich bis heute in einem Konglomerat verschiedener Dialekte und Varianten der deutschen Sprache, die einander bis dahin weitgehend unverständlich gegenüber gestanden sind.
Meine These in unserem Zusammenhang geht dahin, dass wir heute in einer vergleichbaren Situation stehen. Zum Unterschied zu den 1650er Jahren beschränkt sich ein neues Denken über Sprache nicht auf den mitteleuropäischen Raum sondern umfasst im Prinzip alle, bislang voneinander isolierten Sprachengemeinschaften.
Der Stand der Globalisierung erzwingt ein neues Verständnis von sprachlichen Besonderheiten – Englisch ist nur eine Zwischenlösung
Auch wenn uns eine neue Welle von Rückwärtsdenker*innen weißmachen möchte, ihre nationalen Identitätshoffnungen ließen sich noch einmal auf so etwas wie sprachliche Einheit von Muttersprachler*innen beziehen, macht ein Blick auf den Stand der globalen (zugegeben ökonomisch dominierten) Beziehungen deutlich, dass mit dem Bestehen auf die Dominanz einer spezifischen „Muttersprache“ kein Staat mehr zu machen ist. Diese Entwicklung findet sich auch in den vier Grundfreiheiten der Europäischen Union wieder, die von einer Freiheit des Personenverkehrs zumindest innerhalb seiner Grenzen spricht und damit wohl auch Überlegungen zur universellen sprachlichen Verständigung miteinschließt.
Und so ist es nicht verwunderlich, dass in Unternehmen wie Infineon, in denen Beschäftigte aus über hundert Sprachgemeinschaften zusammenarbeiten, Englisch zur Lingua franca geworden ist (Absurder Weise wird Englisch mit dem Brexit mit Ausnahme allenfalls von Malta (dort als Zweitsprache) und Gibraltar (freilich als Teil von UK) keinerlei muttersprachliche Assoziationen aufkommen lassen). Ähnliche Entwicklungen finden sich auch im wissenschaftlichen Bereich, wenn einzelne, vor allem naturwissenschaftliche und technische Fachrichtungen sich längst dazu entschlossen haben, ihre Arbeiten nur mehr in englischer Sprache zu publizieren, zumal die rein deutschsprachige wissenschaftliche Community für sich genommen bedeutungslos geworden ist. Und auch der Umstand, dass mehr und mehr Einträge in den sozialen Medien verfasst sind, weist in eine ähnliche Richtung.
Kunst als universell-sprachliches Phänomen
Dass diese Entwicklung vor dem Hintergrund der Ausgestaltung von Migrationsgesellschaften mittlerweile auch Eingang in den Kunstbetrieb genommen hat, ist unübersehbar. So hat die Zugehörigkeit eines Künstlers bzw. einer Künstlerin zu einer nationalen Sprachgemeinschaft zuletzt dramatisch an Bedeutung verloren. Ein Blick in die Liste der Studierenden an Kunstuniversitäten belegt die pluri-linguale Zusammensetzung der einzelnen Kunstklassen.
Es liegt nahe, dagegen das Argument, dass eine solche Globalisierung des Kunstbetriebs sich nur auf diejenigen Kunstsparten, die sich außersprachlicher Medien bedienen, beziehen würde, ins Treffen zu führen. Und doch tragen auch die sprachbasierten Künste dem Umstand der sprachlichen Vervielfältigung zunehmend Rechnung, nicht nur in Form von Übersetzungen. So hat der kommende Burgtheaterdirektor Martin Kusej bereits in seiner Antrittspressekonferenz angekündigt, die Weiterentwicklung der „ersten deutschen Bühne“ in ein „weltoffenes Theater“ angekündigt, in dem auch nichtdeutsche Aufführungen auf die Bühne kommen sollen.
Die kapitalistisch getriebene Innovationsdynamik wird Fakten schaffen: Der Turm zu Babylon wird doch noch gebaut werden
Beenden möchte ich diese Überlegungen zur Zukunft der Sprache in einer Welt der – politisch im ökonomischen Kontext durchaus gewünschten – Flexibilität und grenzüberschreitenden Mobilität mit einer zugegeben gewagten These. Diese baut auf der Vermutung, dass der babylonische Turm doch noch vollendet werden kann. Und zwar nicht auf Englisch sondern auf der Grundlage der ganzen Sprachenvielfalt.
Meine Vermutung läuft darauf hinaus, dass die laufenden technologischen Innovationen im Bereich der Künstlichen Intelligenz einen grundstürzenden Kulturwandel herbeiführen werden. Dieser wird den Charakter von Sprache als ein traditionelles Kulturgut nachhaltig verändern. Fast täglich kommen in diesen Tagen neue selbstlernende Übersetzungsprogramme auf den Markt, die uns das Verständlich-Machen trotz unterschiedlicher Sprachzugehörigkeit erleichtern. Schon jetzt können wir in Schulklassen mit einem hohen Anteil mit Schüler*innen nichtdeutscher Muttersprache beobachten, wie Sprach-Apps die jungen Menschen in die Lage versetzen, dem Unterricht trotz dementsprechender Sprachkompetenzen zu folgen.
Mit der wachsenden Lernfähigkeit von Computerprogrammen steht zu erwarten, dass schon in sehr absehbarer Zeit Applikationen auf den Markt kommen werden, die uns die Verfügbarkeit von Inhalten in welcher Sprache auch immer ermöglichen werden. Diesbezügliche Übersetzungsprogramme (allenfalls sogar als Chip in unsere Körper eingepflanzt) werden die bestehenden Sprachbarrieren dramatisch senken und damit – auch – die hohe ideologische Aufgeladenheit von Sprache in ihren jeweiligen national-kulturellen Kontexten reduzieren. Und ehe man es sich versieht, werden sich Sprachpurist*innen in musealen Reservaten wiederfinden.
Wir werden uns in allen Sprachen umfassend verständigen können
Wir werden uns also einfach verständigen können, mit wem auch immer und in welcher Sprache auch immer. Und das überall und zu jeder Zeit. Und wir werden den Verlust einer dominanten „Muttersprache“ so wenig als Verlust begreifen wie die gemeinsame europäische Währung oder – wie das noch vor wenigen Jahren der Fall war - den Wegfall von Grenzkontrollen (diese repräsentieren als eine historische Farce in diesen Tagen ein letztes Aufbäumen gegen die neuen transnationalen Realitäten, die – ob wir es wollen oder nicht – längst unser Leben bestimmen).
Ja, der Preis dafür ist hoch. Senthuran Varatharajah zufolge wird mit dem Verlust der Bedeutung von Muttersprachenzugehörigkeit ein zentraler Baustein auf der Suche nach Identität abhandenkommen. Stattdessen werden sich auch im Zusammenhang mit Sprache die Prinzipien globaler Modernisierung anhand ihrer technologischen Errungenschaften durchsetzen.
Und wir werden lernen müssen, mit damit verbundenen Formen der Zeitlosigkeit und Ortlosigkeit als neue kulturelle Phänomene umzugehen. Was wir dafür bekommen sollte den Preis wert sein: die Vertiefung des Verständnisses von der Gleichwertigkeit aller Menschen, egal welcher Sprachengemeinschaft sie entspringen, um sich auf den Weg zu machen, diese auf der Suche nach kulturellem Neuland zu überwinden.
Und die österreichische Bundesregierung wird sich anstatt der Deutschförderklassen neue Schikanen einfallen lassen müssen, um Menschen anderer als deutschsprachiger Herkunft zu diskriminieren.
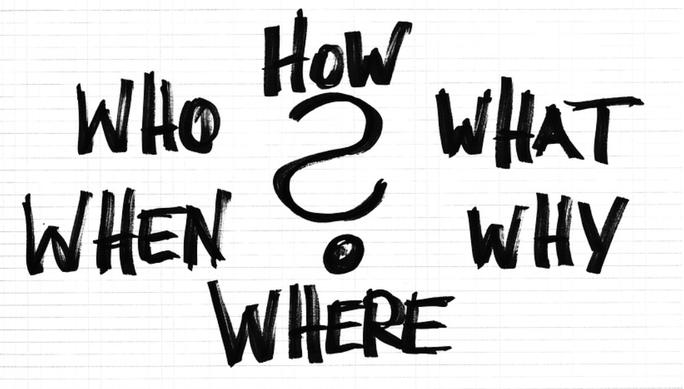
geralt/pixabay
