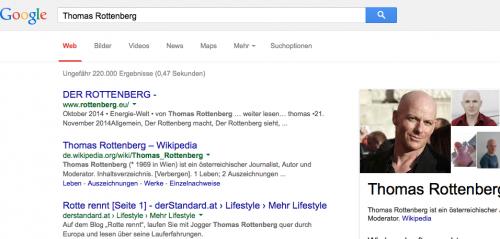
Ich bin ein Rassist (revisited).
Keine Ahnung, ob dieser Google-Treffer immer noch aufscheint. Und wenn ja, ob er immer noch der zweite oder dritte ist, der bei meinem Namen kommt: Ich google mich nicht. Und habe längst aufgehört, mich über die Reihung von Suchmaschinen-Treffern zu wundern. Oder zu ärgern: das Internet hat immer recht - und ich bin daher also ein Rassist. Der Link, in dem das steht, führt zu einer Seite einer zwar marginal relevanten und sektiererischen Anti-Rassismus-Gruppe. (Anmerkung der Redaktion: Wir waren so frei und haben Rottenberg gegoogelt).
Schenk uns bitte ein Like auf Facebook! #meinungsfreiheit #pressefreiheit
Danke!
Die Partie hat schon ziemlich viele Leute, die nicht zu hundert Prozent auf ihrer Linie fahren, als üble Rassisten, Sexisten, Anti-Feministen oder sonstwas mit Pfui-Geruch enttarnt und geoutet: Selbstgerechte Spinner gibt es immer - aber irgendeines „-ismus“ geziehen zu werden, ist halt trotzdem latent unleiwand.
Mein „Vergehen“? Siehe oben. Zu banal, um es nach all den Jahren noch einmal aufzuwärmen. Googeln Sie, falls es Ihnen wichtig ist - und haben Sie Spaß an falschen und/oder willkürlich zu „Beweisen“ zusammengesetzten Zitaten.
Oder sparen Sie sich die Mühe: Ich bin nämlich Wiederholungstäter. Und liefere ja im nächsten Absatz den Beweis, dass alles, was man mir an xenophober Attitüde und Wesensart schon bisher nachsagte, noch untertrieben ist.
Ich bin nämlich ein "unglaubliches Rassistenarschloch, das perfekt in dieses verfickte Naziland passt“. Das bekam ich unlängst mehrfach, mehrsprachig, lautstark und öffentlich an den Kopf geknallt. Und zwar von einem jungen Mann, den ich auf „superg´schissene Herrenmenschen-Art“ grob und unhöflich „zur Sau gemacht“ hätte. Obwohl „ich nicht dein Nigger-Sklave bin, ach wenn du das gerne hättest“. Genau das, erscholl der Ruf, hatte ich soeben versucht.
Was geschehen war? Ich stand an einem Asianudel-To-Go-Stand zur Mittagszeit in einer Warteschlange, die bis fast auf die Straße reichte. Der junge Mann war locker und fröhlich an ihr gegangen, hatte sich neben die soeben bedient werdende Dame gestellte und bestellt. Und ich hatte - aus der Mitte der Reihe (zwar sehr bewusst sehr höflich) gefragt, ob er sich nicht eventuell auch anstellen wolle. So wie - gefühlt - jene 15 Leute, die er gerade ausgebremst hatte.
Der junge Mann explodierte. Aus dem Stand. Er hieß mich zunächst auf deutsch und englisch Dinge und Namen, die mein nicht gerade schlecht bestücktes Vokabular an Flüchen und Beleidigungen im Allgemeinen und Bezeichnungen für unsittlich-erniedrigende Aktivitäten diverser Mütter im Besonderen, deutlich erweiterte. Als ihn daraufhin eine andere Schlangesteherin - ebenfalls demonstrativ höflich - fragte, ob er a) noch ganz bei Trost sei und er b) sich in jedem Fall jetzt bitte hinten anstellen könnte, kam die Rassistennummer: Ich, die Schlangensteherin, jeder im Laden und der Stadt … und so weiter.
Es war quasi ein „urbi et orbi“, das der Vordrängler da spendete - nur eben mit dem Gegenteil eines Segens. Dann drehte er um, spuckte auf den Boden, war mit einem letzten „Nazig’sindel, Rassistenarschlöcher“ auf der Straße und verschwunden. Er hinterließ einen Raum voll fast physisch spürbarer fassungsloser Sprachlosigkeit.
Einer der drei Asiaten hinter der Budel fand als erster die Worte wieder - und rückte die Welt dann in schönem Multiakzent-Wienerisch wieder ins Lot: „Was ging denn mit dem? Stay cool, oida!“ Pause. Dann: „Andererseits: Eigentlich eh leiwand, wenn einer beweist, dass Hautfarbe und Arschlochsein nix miteinander zu tun haben.“
Ach ja: Der Vordrängler war Schwarz.
Ach ja, die zweite: Als ich die Kurzfassung dieser Geschichte auf Facebook erzählte, kam sofort die Frage, wieso ich die Hautfarbe des Mannes erwähnte. Die tue in der Geschichte nichts zur Sache - außer man sei, erraten, Rassist.
Quod erat demonstrandum.
Werde Teil unserer Community und nimm Kontakt zu Journalisten und anderen Usern auf. Registrier dich kostenlosund begeistere unsere Community mit deinen Kommentaren oder eigenen Texten/Blogbeiträgen.
